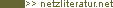
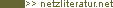 |
|
Reinhard Döhl
Von der Alphabetisierung der Kunst. Zur Vorgeschichte und Geschichte der konkreten Poesie. Das Gesicht der konkreten Literatur ist so international wie uneinheitlich. Nicht nur in zahlreichen Nationalliteraturen, auch in divergierenden politischen Systemen begegnet konkrete Literatur bzw. konkrete Poesie seit Mitte der 50er Jahre in unterschiedlichen visuellen und/oder akustischen Ausformungen mit z.T. konträren Intentionen. Ihre Reduktion auf das konkrete Material der Sprache (Wort, Silbe, Buchstabe) kann affirmativen Charakter aber auch die Funktion sprachlichen Querstellens haben. Weder die Fülle der begleitenden Manifeste noch zahlreiche Erklärungsversuche von Autoren haben bisher über kleinere gemeinsame Nenner hinaus Eindeutigkeit schaffen können. Zwar lassen sich philosophische von linguistischen Erklärungsversuchen trennen, finden sich Abgrenzungsversuche gegenüber konkreter Kunst und konkreter Musik, doch sind dies allenfalls mögliche, idealtypische Annäherungen an eine Literatur, deren Zugang durch unterschiedliche Schrift- und Lautsysteme und vor allem dadurch erschwert wird, daß die konkrete Literatur fluktuierender Bestandteil der grenzüberschreitenden Literatur- und Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts ist. Wenn Anthologisierung und museale Präsentation das Ende einer künstlerischen Tendenz oder Bewegung signalisieren, hätte die konkrete Literatur mit den internationalen Anthologien von Emmet Williams und Stephen Bann, von Mary Ellen Solt und der Ausstellung "Poesia conereta" ihren Höhepunkt deutlich überschritten. Schon gleichzeitige Publikationen, vor allem aber die großen Ausstellungen in Zürich vermeiden entweder das Etikett "konkret", oder versehen es, wie die wohl umfassendste und zugleich Wanderausstellung des Stedelijk-Museums in Amsterdam mit einem deutlichen Fragezeichen. Etwa gleichzeitig mit diesen Ausstellungen beginnt die Lingustik und vor allem die Literaturwissenschaft, sich dem Phänomen einer konkreten Literatur zu nähern. Daneben setzt sich die Präsentation konkreter Literatur in Anthologien fort, tauscht aber zunehmend das Etikett "konkret" gegen das Etikett "visuell" ein und veranstaltet unter dieser Firmierung bis in die jüngste Zeit umfassende Ausstellungen, zuletzt 1984 die Ausstellung " visuelle Poesie" in Saarbrücken, die zusammen mit dem Fernsehen von Klaus Peter Dencker organsiert wurde. Und 1987 in Mainz die Ausstellung "- auf ein Wort! Aspekte visueller Poesie und Musik". Verantwortlich für letztere zeichnet Dietrich Mahlow, der bereits 1963 mit der Ausstellung "Schrift und Bild" den kulturgeschichtlich größeren Rahmen spannte, jetzt aber ausdrücklich die Musik mit einschließt. Schließlich dokumentieren zwei große Ausstellungen, jeweils mit Katalog, einschlägige Museumsbestände, 1986/87 "Fröhliche Wissenschaft. Das Archiv Sohm" in der Stuttgarter Staatsgalerie und "buchstäblich wörtlich wörtlich buchstäblich" [die ehemalige Sammlung Jasia Reichert] 1987 in der Nationalgalerie / Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz. Die Ansätze einer konkreten Literatur, ihre Wurzeln liegen - das hat sich mit dem bisher Zusammengetragenen bereits ergeben - augenscheinlich in der sogenannten Literaturrevolution , genauer: in der literarischen Auseinandersetzung mit einer traditionellen symbolischen Redeweise. Diese Auseinandersetzung führt- wie sich am literarischen Werk Arps sehr schön ablesen ließe - zu Ergebnissen, an die eine konkrete Literatur fast nahtlos anschließen, auf die eine konkrete Literatur folgenreich aufbauen konnte. Nimmt man Hans Arp beim Wort, haben Wassily Kandinsky, Hugo Ball, Tristan Tzara und Arp selber wesentlich zur Klärung des konkreten Gedichtes beigetragen. Ergänzt werden muß diese Liste vor allem noch um den Namen Kurt Schwitters'. Je nach Datierung umfaßt diese Klärungs-Phase die Jahre 1912 bis 1922, doch ist sie darüber hinaus offen. Nach Auffassung Arps ist dabei Kandinskys Gedichtband "Klänge" nicht nur eines der außerordentlichen großen Bücher, sondern es versammle erstmalig auch konkrete Gedichte. In diesen Gedichten tauchen Wortfolgen und Satzfolgen auf, wie dies bisher in der Dichtung nie geschehen war", notiert Arp 1951 und charakterisiert die "Klänge", bezogen auf den Leser: "Durch die Wortfolgen und Satzfolgen dieser Gedichte wird dem Leser das stete Fließen und Werden der Dinge in Erinnerung gebracht, öfter mit dunklem Humor, und, was das Besondere an dem konkreten Gedicht ist, nicht lehrhaft, nicht didaktisch. In einem Gedicht von Goethe wird der Leser poetisch belehrt, daß der Mensch sterben und werden müsse. Kandinsky hingegen stellt den Leser vor ein sterbendes und werdendes Wortbild, vor eine sterbende und werdende Wortfolge, vor einen sterbenden und werdenden Traum. Wir erleben in diesen Gedichten den Kreislauf, das Werden und Vergehen, die Verwandlungen dieser Welt. Die Gedichte Kandinskys enthüllen die Nichtigkeit der Erscheinungen und der Vernunft Zwei Punkte sind an dieser Charakterisierung und zugleich ersten Definition des konkreten Gedichts besonders wichtig. 1. die Gegenüberstellung von poetisch belehrendem Gedicht (bei Goethe) und sprachlicher Demonstration (bei Kandinsky), eine Gegenüberstellung, die sich - wie schon ausgeführt -für die Geschichte des Gedichts so auflösen ließe: hob Goethe mit Formulierung seines Symbolbegriffs die symbolische als die eigentlich poetische Redeweise von der allegorischen des 17./18. Jahrhunderts ab, unterscheidet sich jetzt das sprachliche Ereignis, die sprachliche Demonstration der "Klänge" deutlich von der symbolischen Redeweise des 19. Jahrhunderts. Daß dabei das lyrische Ich aus dem Gedicht dispensiert wird, ist implizit in Arps Charakterisierung mitgesagt. 2. erklärt Arp das konkrete Gedicht nicht als gegenstandslose, inhaltsleere l'art pour l'art. Im Gegenteil vermittele das konkrete Gedicht durchaus Aussagen, die jedoch nicht mehr in, sondern mit der Sprache den Leser erreichen. Und sein Anliegen sei durchaus kritischer Art, die Enthüllung von Nichtigkeit der Erscheinungen und der Vernunft. Die sprachliche Demonstration des konkreten Gedichtes sei also fähig, das in dieser Welt in Sprache als sinnvoll und vernünftig Postulierte, mit Sprache als sinnlos und unvernünftig erscheinen zu lassen. Damit reklamiert Arp bereits für Kandinskys "Klänge" drei zentrale Aspekte, die von Theoretikern der konkreten Poesie in den 50er Jahren nur scheinbar neu formuliert werden. 1. den Aspekt der Demonstration. Ich neige, schreibt Helmut Heißenbüttel zum Beispiel 1961, in gewisser Weise immer mehr dazu, diese Dinge weder als Gedichte noch als Text zu bezeichnen, sondern als Demonstrationen. Demonstration im Doppelsinn dieses Wortes scheint mir das zu sein, was notwendig ist. 2. und damit zusammenhängend: den Schritt von einem Schreiben in der Sprache zu einem Schreiben mit der Sprache, den Max Bense vor allem immer wieder betont hat, z. B. wenn er konkrete Poesie als bewußte Poesie benannte, die ihre ästhetische Realität ganz und gar in einer Sprache aus Zeichen, deren Klasse sie kombiniert, mitteilt, und diese Zeichen sind zwar Worte, aber das Wort erscheint nicht als konventioneller Bedeutungsträger, sondern muß strikt als konstruktiver Zeichenträger aufgefaßt werden. 3. die Möglichkeit sprachlicher Demonstration des nicht Einverstandenseins, des Querstellens, wie es Franz Mon nennen wird, wenn auch in anderem Kontext. In der Tat sind Kandinskys "Klänge" für die Geschichte einer konkret-visuellen Literatur eine beachtenswerte Vorstufe, weniger, was die äußere, die typographische Erscheinungsform der Texte betrifft, wohl aber auf dem Wege dorthin. Kandinskys berühmtestes Gedicht trägt die Überschrift "Sehen": SEHENKandinskys Gedicht "Sehen" ist nach dem Erstdruck in "Klänge" schon bald nachgedruckt worden, 1916 in der für den Zürcher Dadaismus zentralen Anthologie "Cabaret Voltaire" (dort zusammen mit "Blick und Blitz"), 1920 einleitend in Hugo Zehders Monographie "assily Kandinsky", stets in - wenn auch geringfügig - abweichender Typographie (46), in jedem Fall aber als Zeilenkomposition. Was "Sehen" für die Geschichte einer konkret-visuellen Dichtung interessant macht, ist also nicht das Druckbild, sondern seine durch Titel und Farben dominant visuelle Dimensionierung. Auf den ersten Blick Beschreibung eines abstrakten Bildes, und so wohl auch von Zehder verstanden, stört die direkte Hinwendung an ein du: Breiter sollst du deine Arme ausbreiten.Wenn nicht Selbstansprache, ist hier ganz offensichtlich der Leser angesprochen, wie schon im vorangehenden, ersten Gedicht der "Klänge", dessen letzte beiden Zeilen lauten: Das alles habe ich von oben gesehen und bitte auch euch,Das Sehen hat demnach eine die oberflächliche Bildbetrachtung überschreitende Bedeutung. Das würde auch die scheinbar paradoxe Aufforderung, das Gesicht [...] mit rotem Tuch zu bedecken, erklären, die auf inneres Sehen verweist, auf das Erkennen eines (verborgenen) Sinns: bloß du hast dich verschoben. Stimmt dies, muß der Sinn des inneren Sehens dem Farbereignis des Gedichts, dem Kontrast, den das Trübe zu den Farben bildet, ablesbar sein. Erst dann läßt sich auch entscheiden, was es mit den beiden letzten rätselhaften Zeilen auf sich hat. Daß Kandinsky bei seinen ausgesprochen synästhetischen Fähigkeiten den Farben neben der Klangwirkung Bedeutungen zuwies, ist bekannt. In seinem Essay Über das "Geistige in der Kunst" (47), der 1911/1912 etwa zeitgleich mit den "Klängen" erschien und deshalb interpretatorisch Gewicht hat, erfahren wir über die Bedeutung der in "Sehen" verwendeten Farben, daß Braun stumpf, hart, zur Bewegung kaum fähig, die Farbe des Hemmens (S. 101) ist. Das brausende und gühende Rot (S.99) kann durch Blau wie glühendes Eisen durch Wasser gelöscht werden (S. 100). Blau, die Farbe des Himmels, ist die Farbe der Vertiefung, des Unendlichen und Reinen (S. 92). Schließlich erscheint Kandinsky Weiß als Symbol einer Welt, wo alle Farben, als materielle Eigenschaften und Substanzen verschwunden sind (S.96), als ein Schweigen, welches nicht tot ist, sondern voll Möglichkeiten (ebd.), als Nichts, welches vor dem Anfang, vor der Geburt ist (ebd.). In der Reihenfolge des Gedichts gelesen, umschließen das Blau und das Weiß eine dissonante (pfiff, gedröhnt), durch ihre Mechanik verletzend eindringende Welt (Spitzes, Dünnes, [...] drängte sich ein, stach aber nicht durch. / An allen Ecken). Diese Welt ist zugleich durch die Farbe Dickbraun als sehr stumpf, sehr hart, als äußerst gehemmt charakterisiert, und zwar auf alle Ewigkeiten. Der nur umgangssprachlich mögliche Plural von Ewigkeit könnte andeuten, daß Kandinsky hier ganz konkret die banal alltägliche Welt meint. Doch ist diese in Wirklichkeit eine Scheinwelt (Scheinbar. Scheinbar.), der eine innere Welt kontrastiert, falls der Mensch bereit ist, sie anzunehmen (Breiter sollst du deine Arme ausbreiten. Breiter. Breiter.), sie (innerlich) zu schauen (Und dein Gesicht sollst du mit rotem Tuch bedecken). Da das Blau des Anfangs das Rot wie glühendes Eisen durch Wasser löschen kann, stellt sich eine neue Sicht der Welt ein, für die jedoch nicht entschieden werden kann, ob sie sich oder die Sicht auf sie, ob sich Welt oder Weltanschauung geändert haben. Die folgenden Zeilen sind inhaltlich wie formal interessant. Ein Sprung ist entweder ein Riß, ein aufgesprungener Spalt oder eine ausgeführte Bewegung. Entweder bekommt das Blau weiße Sprünge oder das Weiß springt, und vollzöge dann eine halbkreisförmige Bewegung vom Absprung über den Scheitelpunkt zum Aufsprung. Die vier Zeilen selber vollziehen formal eine Kreisbewegung, kehren also zum Ausgangspunkt zurück. So gelesen träten zur Welt ohne materielle Eigenschaften und Substanzen, zum Schweigen [...] voll[er] Möglichkeiten, zum Nichts [...] vor dem Anfang, vor der Geburt der Kreislauf, das Werden und Vergehen, die Arp in den "Klängen" Kandinskys sprachlich vorgeführt sah. Doch ist damit der Text noch nicht an seinem Ende. Das scheinbar zu einer Lösung gelangte Farbereignis hat nämlich, und damit kommt noch eine dritte Bedeutung des Sehens, das Erkennen ins Spiel, den Blick auf das Trübe, den Blick darauf verstellt, daß es, und das heißt das Eigentliche und Zukünftige noch im Trüben sitzt, aus dem es sich nur explosionsartig freisetzen kann. So jedenfalls ließe sich der etwas überraschende Gedichtschluß deuten, der dann zugleich etwas von den revolutionären Hoffnungen ablesen ließe, die Kandinsky mit seiner neuen Kunstproduktion verband. Die Schwierigkeiten, die dieser Text Kandinskys den Interpreten bereitet, resultiert sicherlich auch daraus, daß es Kandinsky in "Sehen" noch nicht schlackenlos gelungen ist, seine Vorstellung der Abstraktion auch ins Gedicht umzusetzen, den Schritt vom Außenbild zum Innenbild auch sprachlich zu vollziehen. Das gelingt in anderen Gedichten der "Klänge" durchaus besser, und zwei von ihnen sollen deshalb hier zitiert werden, zunächst das Gedicht "Anders", das einleitend wiederum eine Bildbeschreibung, in diesem Fall die formale Beschreibung einer weißen Ziffer auf dunkelbraunem Grund zu sein scheint. ANDERSFormal wiederholt sich in diesem Gedicht die schon von "Sehen" her vertraute Kreisbewegung, diesmal von der letzten Zeile zurück zum Titel, der damit nachträglich eine zweite Bedeutung bekommt, denn nicht nur der obere Haken der 3 ist anders als der untere, sondern möglicherweise ist dies auch anders (sprich: umgekehrt der Fall). Auch einen zweiten Kunstgriff Kandinskys haben wir in "Sehen" schon kennen gelernt, die Iteration. Blaues, Blaues hob sich, hob sich. Dreimal wird scheinbar und breiter wiederholt, achtmal der weiße Sprung, zweimal das Trübe. Diese Wiederholungen hat Kandinsky in seinem Essay "Über das Geistige in der Kunst" auch theoretisch begründet als Möglichkeit, dem Wort den äußeren Sinn der Benennung zu nehmen und seinen reinen Klang zu wecken (S. 46). Das kann fraglos als ein Vorgriff auf das verstanden werden, was später in der Theorie der konkreten Poesie als Materialität des Wortes, als sein Materialcharakter bezeichnet wird, erfährt aber - wie ich noch zeigen werde - bereits bei Schwitters eine erste theoretische Radikalisierung. In welchem Maße Max Benses Diktum, Ein Wort, das konkret verstanden werden soll, muß ganz und gar beim Wort genommen werden (49), bereits auf Kandinskys "Klänge" anwendbar ist, zeigt zum Beispiel das Gedicht "Anders", indem es entsprechend seinem Gegenstand, der Ziffer 3, das den Text strukturierende etwas je dreimal wiederholt. In der Beschreibung einer in der Regel formal symmetrischen Ziffer als asymmetrisch, in der typographischen Betonung des etwas steckt aber nicht nur der Witz dieses Gedichtes, zu dem auch die ironische Brechung des Titels durch die Schlußzeile gehört, sondern man kann hier ansatzweise durchaus schon von material-visuellen Schritten sprechen. Im dritten Gedicht Kandinskys, das ich aus den "Klängen" zitieren möchte, dominiert die Form fast schon den Inhalt. OFFENDie schon bekannten Kunstgriffe Kandinskys wiederholen sich auch hier, 1. die Iteration, fast schon als steigernde Reihung.Hinzu kommt als formal Neues die Reduzierung, die Reduktion, entscheidendes Charakteristikum für einen Teil der späteren konkreten Literatur, z.B. für Gomringer. Diesmal nicht nur als inhaltliche Reduzierung auf die banale Ziffer wie in "Anders", sondern jetzt auch vokabulär und formal. Dabei erinnert der Text in seiner Abfolge von längeren und kürzeren Zeilen bei zunehmend syntaktischer und formaler Verknappung auf die Ein-Wort-Zeile Rohre entfernt an Orgelpfeifen, an die griechische Hirtenflöte, die Syrinx, die wörtlich mit Rohr, Röhre zu übersetzen wäre. Das würde dann zu den OF[F]EN/Rohre[n] kontrastieren und diesem Text einen zusätzlichen einen hintergründigen Witz, Arp sprach ja von dunklem Humor, geben. Ob Kandinsky daran gedacht hat, muß 'offen' bleiben. Daß dieser Text aber bereits deutlich auf dem Wege zum Figuratum ist, steht für mich außer Frage. Und er weist dabei über die zeitlich etwas späteren "Calligrammes" Guilleaume Apollinaires, auf die sich die visuell ausgerichtete konkrete Poesie immer wieder berufen hat, bereits hinaus. Denn von ihrer Veräußerlichung traditionell lyrischer Requisiten ins Typogramm unterscheidet er sich durch die Banalität seines Sujets. Obwohl Hans Arp für sich, Hugo Ball und Tristan Tzara reklamiert, Wesentliches zur Klärung des konkreten Gedichtes beigetragen zu haben, ist der Beitrag des Zürcher Dadaismus zur konkret-visuellen Literatur eher gering zu veranschlagen, der Einfluß Kandinskys jedoch nicht zu unterschätzen. Das ist auch der Grund, warum ein Überblick über die Vorgeschichte der konkret-visuellen Literatur in Deutschland den Zürcher Dadaismus wenigstens streifen muß. Wie Arp hat auch Hugo Ball in einem Vortrag in der "Galerie Dada" sich schon 1917 mit der Bedeutung Kandinskys auseinandergesetzt und, auf dessen literarisches Werk bezogen, formuliert: Als der erste auch in der Poesie hat Kandinsky rein spirituelle Vorgänge dargestellt. Mit den einfachsten Mitteln gestaltet er in den 'Klängen' Bewegung, Wachstum, Farbe und Ton [...]. Die Negierung der Illusion geschieht hier noch durch Gegeneinanderstellen sich aufhebender Illusionselemente, die der konventionellen Sprache entnommen sind. Nirgendwo, auch bei den Futuristen nicht, hat man eine ähnlich kühne Purifikation der Sprache versucht. Und Kandinsky ist auch den letzten Schritt noch weitergegangen. Er hat im 'Gelben Klang' als Erster den abstrakten Lautausdruck, der nur aus harmonisierten Vokalen und Konsonanten besteht, gefunden.Balls Hinweis auf Kandinskys Bühnendichtung "Der gelbe Klang") bezieht sich auf Regieanweisungen wie Chor ohne Worte, Singen ohne Worte, auf eine angsterfüllte Tenorstimme, die vollkommen undeutliche Worte sehr schnell schreit (oft hört man a: z.B. Kalasimunafakola!). Pause. Es wird für einen Augenblick dunkel. Das ist natürlich bereits Musik, auf die schon Kandinskys Gedichtbandtitel "Klänge" verwies. Gleichfalls in die Traditionslinie einer konkret-akustischen Literatur gehören auch Hugo Balls eigene Lautgedichte, "Verse ohne Worte", die er am 23. 6. 1916 im Cabaret Voltaire vortrug und in seinem Tagebuch "Flucht aus der Zeit" theoretisch begründete. Als akustischer Text sind sie kein Gegenstand sind sie bereits diskutiert und auch kein Gegenstand im augenblicklichen Kontext, wohl aber in ihrer typographischen Erscheinung, und die ist im Falle der "Karawane" auffällig genug. KARAWANERichard Huelsenbeck, der 1920 die "Karawane" in dieser Form in seinen "Dada Almanach" aufnahm, hatte diesen Text von Ball im Vortrag gehört und kannte mutmaßlich auch seine Partitur. Das Schriftbild des Drucks, der Wechsel von Schrifttypen und -graden ist also als Versuch zu werten, die Partitur eines akustischen Textes in adäquate Typographie umzusetzen. Das gewinnt der Partitur eine visuelle Selbständigkeit, auf die zu achten ist. Man hat in letzten Jahren mehrfach die visuell orientierten Partituren moderner Musik, moderner akustischer Kunst in Ausstellungen präsentiert, sich bisher aber nie die umgekehrte Frage gestellt, ob nämlich nicht mancher visuell ansprechend gedruckte Text Partiturcharakter hat. [Vgl. Grafische Partituren / Musikalische Grafik]. Das gilt exemplarisch für Mallarmes "Un Coup de Dés", auf den sich Gomringer und nach ihm andere immer wieder für ihre Konstellationen und visuellen Texte berufen haben. Sie alle haben nämlich überlesen, [was Ferdinand Kriwet bereits bei seiner Unterscheidung von Seh- und Hörtexten nachdrücklich festhielt; s.d.], daß Mallarmé in seinem Vorwort ausdrücklich schreibt: Ajouter que de cet emploi a nu de la pensee avec retraits, prolongements, fuites, ou son dessin même, résulte, pour qui veut lire a heute voix, une partition (Anzufügen wäre, daß aus dieser bis zum äußersten vorgetriebenen Anwendung des Denkens, mit Zurücknahmen, Ausweitungen, Ausbrüchen, oder aus dem Schriftbild für den, der laut lesen will, eine Partitur hervorgeht). Daß auch dieser Hinweis inzwischen beim Wort genommen wurde, belegen zwei markante akustische Produktionen Paul Pörtners im Umfeld des Neuen Hörspiels, die "Schallspielstudie II" von 1965 und "Alea" von 1970. Von dieser und einigen wenigen anderen Ausnahmen abgesehen, sind die Beiträge des Zürcher Dadaismus zur Vorgeschichte einer konkreten Literatur ausschließlich Onomatopoien, also ihrer akustischen Spielart zuzurechnen. Das gilt insbesondere für Arps Gedichte "der wolkenpumpe", die von ihm selber als konkret bezeichnet werden. Ein von ihm selbst später aufgenommenes Beispiel ist auch deshalb aufschlußreich, weil Arp beim Sprechen den Tonfall priesterlicher Lamentation wählt: noch ist hier der minotauros koloß schoß der efi bilindi klirr kümmeltürkulum aber nimm die schildwachen aus und sage dragonat glisandra bum bum i bim dann zeigt er sein knochenbild im aquarin und an der steinschnur tropft der stern immenschwanz und der zerbrochene lauf arbeitet und kocht in saphyri so nun tu durch biß wirkung und der kreatur ist saphyri aber wir wollen dergebild mutmaßen aus gestein horn pfrundenblei daß es bricht daß der grund oder profil sich erzeigt dann wird das arschleder des winzigen sich lüpfen und die orchestermänner auf den minaretten die gewitter und turteltauben beeinflussen respektive anziehen doch die schwarze raumkugel zerlegt sich in ihre inhalte und der schellenvogel kommt nackicht hervor element or blitzmehl zwergolin rankt um die lehrmeister und stellet sich dar als imprudentia welche die fata morgana mit papageienstaub salbet also auch der anatomie anno domini mene tekel caroline wird sich erbringen mit kerben im geistigen leib tapeziert ohne resonanz mit dem wenig beweglichen taubenmahl.Für die Entwicklung konkret-visueller Literatur von einiger Bedeutung ist die Entdeckung der Zeitung als Materialquelle, als Fundus sowohl für die Texte wie für die Möglichkeit der Collage. In einer Traditionslinie, die sich von den Kubisten herschreibt, haben sich Arp, Tzara, dann auch Schwitters und andere zur Herstellung von Texturen gerne der Zeitung, oft speziell ihres Inseratenteils bedient. In "Pour faire un poeme dadaiste" schreibt zum Beispiel Tristan Tzara vor: Prenez un journal.Das von Tzara im Anschluß an sein 'Rezept' mitgeteilte Bei-spiel ist in meinem Zusammenhang nicht interessant, dagegen die Vorstellung, daß sich dieser atomisierte Zeitungstext leicht auch in eine visuell ansprechende Partitur collagieren ließe, die von ihrem Material her der poetischen Bemühtheit Mallarmes deutlich kontrastieren würde, in der Typographie dagegen seinem "Coup de Dés" sehr wohl entsprechen könnte. Den hier für die Entwicklung konkret-visueller Literatur entscheidenden Schritt vollziehen Raoul Hausman und Kurt Schwitters. Raoul Hausmann bemüht sich nicht einmal mehr um eine Textvorlage für seine Gedichte, sondern greift gleich zur Letter. [Plakatgedicht]Waren schon Arps "wolkenpumpe" wie auch Tzaras Beispielgedicht interpretatorisch kaum mehr zugänglich, verwehren Hausmanns "Plakatgedichte" jegliche semantische Assoziation. Sie wollen nurmehr gesehen und, so paradox es klingt, gelesen, was heißen soll: artikuliert werden. In der Tat hat Hausmann seine Texte wiederholt selbst vorgetragen, ist vor allem das zweite dieser "Plakatgedichte" von 1918 literaturgeschichtlich bedeutsam geworden, denn auf ihm hat Schwitters seine "Ursonate" aufgebaut, aus ihm hat er sie in jahrelanger Arbeit entwickelt. Dieser Partiturcharakter des Gedichts, diese seine Doppelung als visuelles und als akustisch realisierbares Gebilde, hat Raoul Hausman 1920 bewogen, einige Arbeiten "Optophonetische Gedichte" zu nennen, wie zum Beispiel das folgende [Optophonetisches Gedicht]Noch entschiedener als bei Hausmann ist aber bei Kurt Schwitters der Schritt zur konkreten Literatur, so sehr, daß, wie bereits genannt, Friedhelm Lach sowohl in seiner Schwitters-Monographie als auch in der Edition des literarischen Werkes der "Konkreten Poesie" ein eigenes Kapitel widmet, eigenen Raum zuweist, wobei Lach zwischen "Dichtung und Bild" und "Dichtung und Musik" unterscheidet. Diese konkret-visuellen und akustischen Texte beanspruchen in der Werkausgabe immerhin einen Umfang von 79 Seiten, der noch um einiges anschwellen würde, nähme man auch jene Collagen hinzu, auf denen nach dem Willen Schwitters' Sätze gelesen werden sollen. Wie bei Raoul Hausmann gibt es bei den visuellen Texten Kurt Schwitters' ebenfalls Beispiele, die gesehen und gehört werden können. Das gilt sogar für die meisten der hier einschlägigen Gedichte und erklärt sich aus Schwitters' Bemühen um ein Gesamtkunstwerk. Da dieses nur im Entwurf möglich war, beschränkte sich Schwitters darauf, zunächst [...] einzelne Kunstarten miteinander zu vermählen, also sehbare Gedichte und lesbare Bilder zu schaffen. Im Bereich der vorrangig visuellen Texte ist dabei ein Reduktionsschritt zu beobachten von Gedichten mit wenigen, zumeist einsilbigen Wörtern, bei denen es sich auch um ausgeschriebene Zahlen handeln kann, zu Gedichten, die nurmehr aus Buchstaben oder Ziffern bestehen. In seinem Manifest aus dem Jahre 1924, "Konsequente Dichtung" hat Schwitters diesen Reduktionsschritt auch theoretisch begründet. Er geht dabei davon aus, daß das Wort 1. Komposition von Buchstaben,ist. Eine Dichtung aus Ideenassoziationen (Schwitters' Beispiel ist hier Goethes Über allen Gipfeln ist Ruh) sei heute nicht mehr möglich. Die abstrakte Dichtung, für die Schwitters kein Beispiel nennt, doch ist es nützlich, sich zu erinnern, daß die Dichtung des "Sturm"-Kreises um Herwarth Walden, zu denen Stramm zählte, von dem wiederum Schwitters wesentliche Impulse empfing, paradigmatisch als abstrakte Dichtung genommen werden kann, - Diese abstrakte Dichtung löste, schreibt Schwitters, das Wort von seinen Assoziationen, und wertete Wort gegen Wort, speziell Begriff gegen Begriff, unter Berücksichtigung des Klanges. Dennoch sei auch sie noch nicht konsequent genug gewesen, vergleiche man sie mit der dadaistischen Collage, in deren materialem Nebeneinander die Begriffe viel klarer zu werten seien, als in ihrer übertragenen Bedeutung im Wort. Auch den Klang zum Träger des Gedichtes zu nehmen, sei noch nicht konsequent. Denn Klang sei nur bei der akustischen Realisation eindeutig. Sein Material müsse nicht einmal Dichtung sein. Man kann z.B. das Alphabet, das ursprünglich bloß Zweckform ist, so vortragen, daß das Resultat Kunstwerk wird. Die konsequente Dichtung sei dagegen ausschließlich aus Buchstaben gebaut, die weder Bedeutungsträger seien noch an sich einen Klang hätten. Das konsequente Gedicht wertet Buchstaben und Buchstabengruppen gegeneinander. Was nicht ausschließe, daß man das Ergebnis durch Vortrag auch als Klang werten könne, wie es Schwitters dann ja auch mit seiner "Ursonate" demonstriert hat. Was aber auch nicht ausschließt, wie man hinzufügen muß, daß das Buchstabenarrangement beim Leser semantische Assoziationen zuläßt. Der in Schwitters "Konkreter Poesie", wie Lachmann sagt, in Schwitters "Konsequenter Dichtung", wie man es vielleicht besser sagen sollte, zu beobachtende Reduktionsschritt von Gedichten mit wenigen Wörtern zu Gedichten aus Buchstaben und Ziffern könnte gleichsam als Illustration seines Manifestes studiert werden. Ein noch aus dem Werten von Wort gegen Wort entstandener, also der abstrakten Dichtung nahestehender Text ist das 1921 erstmals veröffentlichte Gedicht WANDFriedhelm Lach hat in seiner Schwitters Monographie kommentiert, dieses Gedicht bestehe aus fünf Zahlen und den Wiederholungen eines einzelnen Wortes 'Wand' [...]. Siebenundzwanzigmal reiht Schwitters es aneinander und fügt das Wort 'Wände' noch zehnmal hinzu. [...] Nicht Inhalte, sondern Worte werden [...] in seinem Gedicht 'Wand' gewertet. Sie werden in rhythmischen Folgen zusammengestellt. Bei solch einer 'absoluten' Dichtung muß die Art des Vortrages alles vermitteln. Sie lebt von Crescendo und Decrescendo, und den subtilen Ausdrucksnuancen des Vortrags. Am Ende steht eine Klang- und Rhythmuskompositon im Raume, das Wort ist aus dem Assoziationsfeld genommen und zu einem Klangwert geworden. Schwitters versuchte auf die wechselnde Vortragsweise schon durch Groß- und Kleinschreibung sowie durch verschiedene Schriftgrade aufmerksam zu machen. Nur: die Sache ist so eindeutig nicht. Sicherlich ist dieses Gedicht auch für die akustische Realisation bestimmt, gilt das für die typographische Partitur bereits Angemerkte. Aber es gilt auch, was Schwitters für das abstrakte Gedicht einschränkt, das Wort als Bedeutungsträger. Und hier hat Lach nicht genau gelesen. Denn neben den Zahlen Fünf bis Eins steht das Wort Wand nur einundzwanzigmal, achtmal das Wort Wände, wobei zwischen den Schreibweisen in Majuskeln und als einfaches Substantiv noch nicht unterschieden ist. Dazu ordnen sich zweimal das Wort wände und siebenmal das Wort wand. Natürlich ist nicht auszuschließen, daß Schwitters der Schreibung in Majuskeln hier die Schreibung in Minuskeln zuordnet. Aber Schwitters war sprachverspielt genug, um zu sehen, daß er damit zugleich Imperfekt und Konjunktiv des Verbs winden verwandte, das wortgeschichtlich wiederum mit Wand verwandt ist. So kann umgekehrt auch nicht ausgeschlossen werden, daß WAND und WÄNDE Großschreibungen von wand und wände sind. Dadurch erhält der Text eine nicht aufzulösende Mehrdeutigkeit, zumal in der Regel ein Raum vier, nicht fünf Wände hat, das Rückwärtszählen von Fünf bis Eins sogar den Einwand noch herbeiassoziiert. Ein ebenfalls aus Worten, in diesem Fall aus ausgeschriebenen Zahlen bestehender Text ist ZwölfAuch in seinem Fall werden nicht nur Zahlen gewertet, ist Bedeutung durchaus beabsichtigt. Dem Titel Zwölf entsprechen (die Überschrift mitgerechnet, zwölf, sonst) elf Zeilen. Zwar kommt die Zahl Zwölf im Text selber nicht vor, aber er zählt erkennbar zu ihr hin und wieder von ihr weg, in einer Bewegung, die dem Vor- und Rückwärtszählen der Zeilen 1/2 und 3/4 entspricht. Nach iterativer Betonung der Sieben, die in Aberglauben und Mythologie des Abendlandes eine besondere Rolle spielt, steigen die Zahlen zügig in Addition, vor allem, wenn man liest: Acht (und) Eins (ist) Neun (und) Eins (ist) Zehn (und) Eins (ist) Elf. Liest man jetzt weiter, müßte auf: Elf (und) Eins die erwartete Zwölf folgen. Statt ihrer folgt aber die Zehn, die Zeile zuvor wäre demnach zu lesen: Elf (weg) Eins. Elf Eins ist demnach die entscheidende Zeile des Textes, Höhe- und Wendepunkt zugleich. Die im Titel angekündigte Zwölf (mit einer der Zahl Sieben entsprechenden Rolle in Aberglauben und Mythologie) stellt sich nicht ein. Von der ausgeschriebenen Zahl zur Ziffer, vom Wort zum Buchstaben ist es dann nur noch ein konsequenter Schritt, obwohl Schwitters auch hier durchaus semantische Anspielungen zuläßt, in einigen seiner Alphabet-Texten sogar bewußt typographisch provoziert. Die Reduktion des Textes auf das Alphabet war nicht Schwitters Erfindung. Bereits 1920 hatte Louis Aragon unter der Uberschrift "Suicide" lediglich fortlaufend die 26 Buchstaben des Alphabets versammelt (63). Ob Schwitters diesen Text gekannt hat, war nicht zu ermitteln. Mit Sicherheit war seine Intention jedoch eine andere, entsprachen seine Alphabet-Texte seinen konsequenten Reduktionsschritten. Sein Alphabet hat übrigens, da seine Schreibmaschine den Buchstaben J nicht hatte, nur 25 Buchstaben. Zwei von ihnen sind besonders interessant, das "Alphabet von hinten" und "Register". Alphabet von hintenEin rückläufiges Alphabet, also von hinten nach vorne zu buchstabieren. In der mittleren Zeile dann die beiden Buchstaben p und o zu po zusammengerückt. Was es mit den drei weiteren Buchstabenkombinationen (ts, lk, dc) auf sich hat, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. dc könnte für da capo stehen, also dem Alphabet von hinten die Aufforderung 'noch einmal von Anfang an' entgegenstellen. lk ließe sich mit po zu Polk svw. Pulk zusammensetzen, und könnte dann das Alphabet als eine größere Anzahl/Ansammlung von Buchstaben bezeichnen. Auch könnte man von po ausgehend und nach oben im Kreis lesend noch post zusammenbuchstabieren. Dagegen ist mit ts vorläufig nichts anzufangen. Der zweite Alphabettext, das "Register", ist durch ein in Klammern zugesetztes (elementar) ausgewiesen, und damit durch ein Wort, das Schwitters 1922 häufiger zur seiner reduzierten Texte verwendet hat. REGISTERWie im "Alphabet von hinten" fällt auch im "Register" sofort ein eindeutig lesbares Wort ins Auge, der Name des Freundes Hans ARP, [mit dem Schwitters auch anderen Orts gespielt hat, z.B. in einer Merzarp-Zeichnung aus dem Jahre 1938]. Weitere Wortanklänge sind dagegen strikt vermieden, obwohl der Text nicht ohne Störungen durchbuchstabiert. Statt des erwarteten U verzeichnet er, alter Schrift entsprechend ein V, um darauf hin noch einmal mit A B C zu beginnen, dann mit einem Sprung von T bis W vor-wärts und wieder rückwärts zu buchstabieren, auf Z vorzugreifen, das X Y Z nachzuholen und schließlich auf der Mittelachse dreimal gewichtig das Z zu wiederholen. Gerade diese Sprünge signalisieren über das Buchstabenspiel hinaus, daß Schwitters bei "Register" auch an eine akustische Realisation gedacht hat, in der sie dann als rhythmische Sprünge erscheinen würden. Der letzte Schritt zu einem Buchstabentext, der allenfalls noch buchstabiert werden kann, bilden - ebenfalls 1922 - eine Handvoll "Bildgedichte", von denen lediglich eines gedruckt und vorher entsprechend gesetzt wurde, was auch den Zusatz "Gesetztes Bildgedicht" erklären könnte. [Aber hier ist durchaus auf andere Bedeutungen zu achten: könnte gesetzt im Sinne gesetzter Spielfiguren, in diesem Fall gesetzter Buchstaben auf einem Spielfeld gelesen werden; vgl. hier auch dargestellte Schachpartien. Möglich wäre auch ein Verständnis von gesetzt im Sinne von angenommen, gesetzt den Fall. Wenig wahrscheinlich ist die Lesart gesetzt = gealtert]. Die anderen sechs "Bildgedichte" sind handschriftlich tradiert, drei von ihnen (aus der Sammlung Doucet, Paris) tragen als handschriftlichen Titel "Gesetztes Gedicht", sind möglicherweise also schon für den Satz bestimmt gewesen. Wie zuverlässig die von Friedhelm Lach mitgeteilten Titel der drei restlichen Texte sind ("AO Bildgedicht"; "A-A Bildgedicht"; "S-S Bildgedicht"), weiß ich nicht. Auffällig ist allerdings, daß das "AO-Bildgedicht" offensichtlich eine Variante zum "Gesetzten Bildgedicht", das "S-S Bildgedicht" eine Variante zu einem der drei "Gesetzte[n] Gedichte" aus der Sammlung Doucet ist. Diese fünf "Bildgedichte" lassen, die Varianten eingerechnet, drei Schlüsse zu. 1. daß sich Schwitters in ihrem Fall seiner Sache nicht sicher war. Darauf weisen die unterschiedlichen Fassungen hin, das läßt sich aber auch aus der Tatsache schließen, daß er nur eines dieser "Bildgedichte" gesetzt, also veröffentlicht hat, obwohl es dem guten Typographen, der er war, ohne weiteres möglich gewesen wäre, auch die anderen, zum Beispiel in seiner Zeitschrift "MERZ" zu veröffentlichen. 2. ist auch das einzig publizierte "Gesetzte Bildgedicht", beginnt man erst einmal zu buchstabieren, nicht frei von Bedeutungen. AO Bildgedicht / Gesetztes Bildgedicht Buchstabiert man zum Beispiel J-O-B, erhält man ein Kürzel des Namens Hiob, einer Gestalt des Alten Testaments, die in den 20er Jahren und später wiederholt (u.a. in Döblins "Berlin Alexanderplatz") literarisch angespielt wurde. Die Kombinationen A-O bzw. A-Z sind sprichwörtliches Gemeingut für Anfang und Ende. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, heißt es bekanntlich in der Offenbarung des Johannes (1, 8), was sich daraus erklärt, daß der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes Alpha und Omega sind. Dem entspricht in der deutschen Sprache die Redewendung von A bis Z. Ferner sind A, B die beiden ersten Buchstaben des Alphabets, aus dessen ungefährer Mitte die Buchstaben J und O genommen wären. Der mit dem Alphabet arbeitende Künstler auf der einen, der Künstler als Hiob auf der anderen Seite, das wäre sicherlich eine zu abenteuerlichen Interpretationen anregende Entzifferung dieses "Gesetzten Bildgedichtes". Doch bliebe sie allenfalls Buchstabenspekulation, die sich durch nichts weiter begründen ließe. Im Gegenteil will mir scheinen, und das ist zugleich das 3., was ich folgern möchte, daß diese "Bildgedichte" die weiteste Entfernung zum klassischen Gedicht darstellen sollten. Die klassische Dichtung, so wie sie Schwitters in seiner Theorie einer konsequenten Dichtung mit "Wandrers Nachtlied" besetzt hatte, zeichnet sich durch Bilder, durch Bildersprache aus. Bezogen auf solche literarischen Bilder würde ein aus sinnleerem Buchstabenmaterial gesetztes "Bildgedicht" in der Tat das andere Extrem darstellen. Weder entzifferbare Schrift noch erkennbares Bild, träten Bild und Schrift in rudimentärem Zustand in der Typographie als einem tertium compositionis zusammen. Da ihm dies nicht gelingen wollte, hätte Schwitters dann nur konsequent auf die weitere Publikation seiner "Bildgedichte" verzichtet. [Von der Alphabetisierung der Kunst. Zur Vorgeschichte der konkreten und visuellen Poesie in Deutschland. In: Zeichen von Zeichen für Zeichen. Festschrift für Max Bense. Hrsg. von Elisabeth Walther und Udo Bayer. Baden-Baden: Agis 1990] |
|
Copyright (c) by Reinhard Döhl (http://www.reinhard-doehl.de).
|